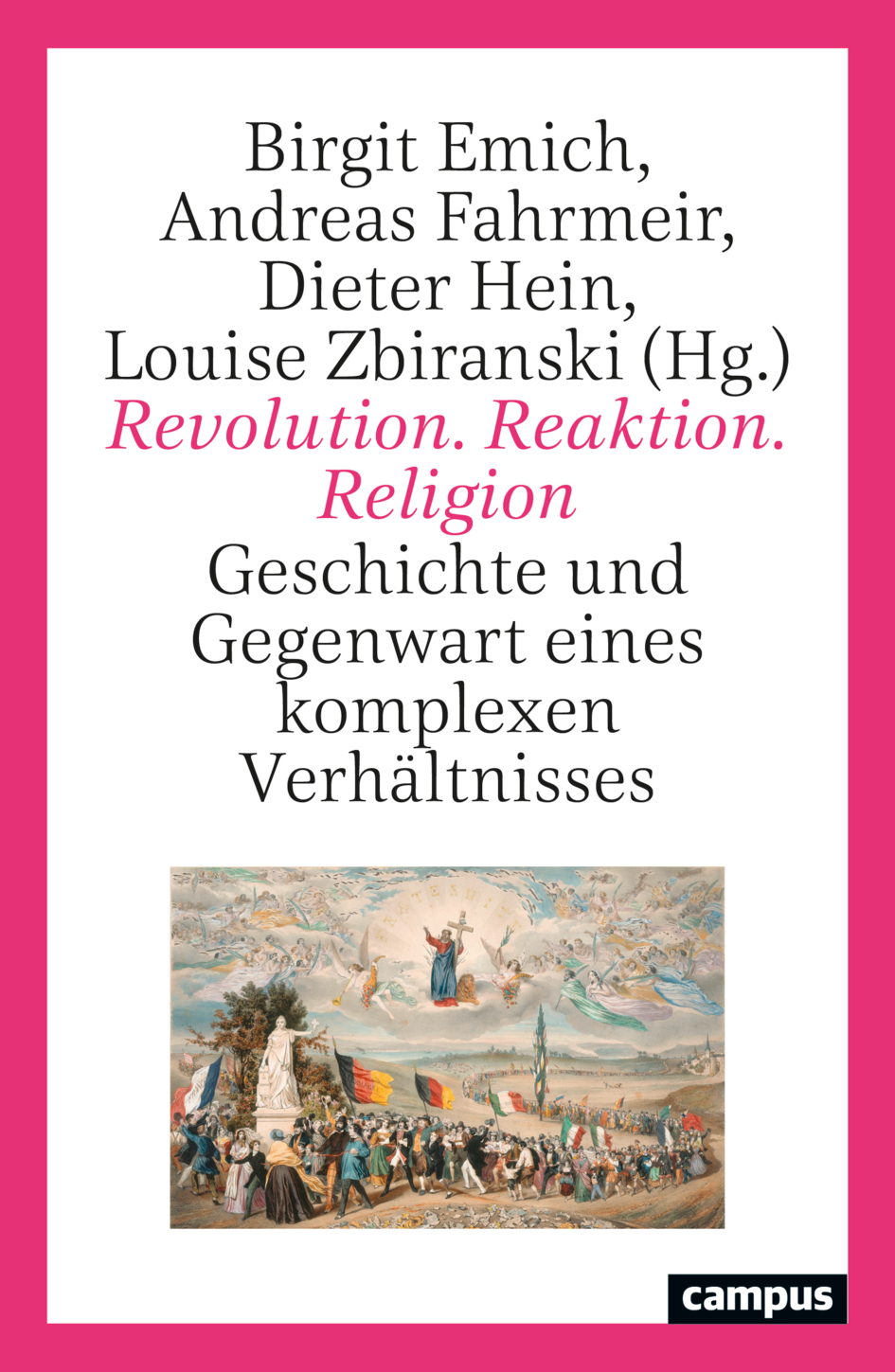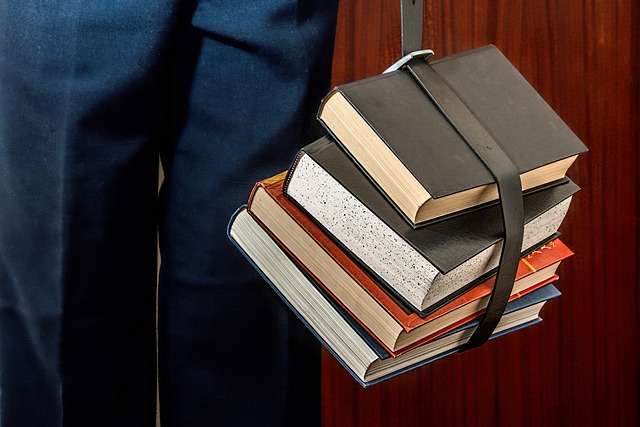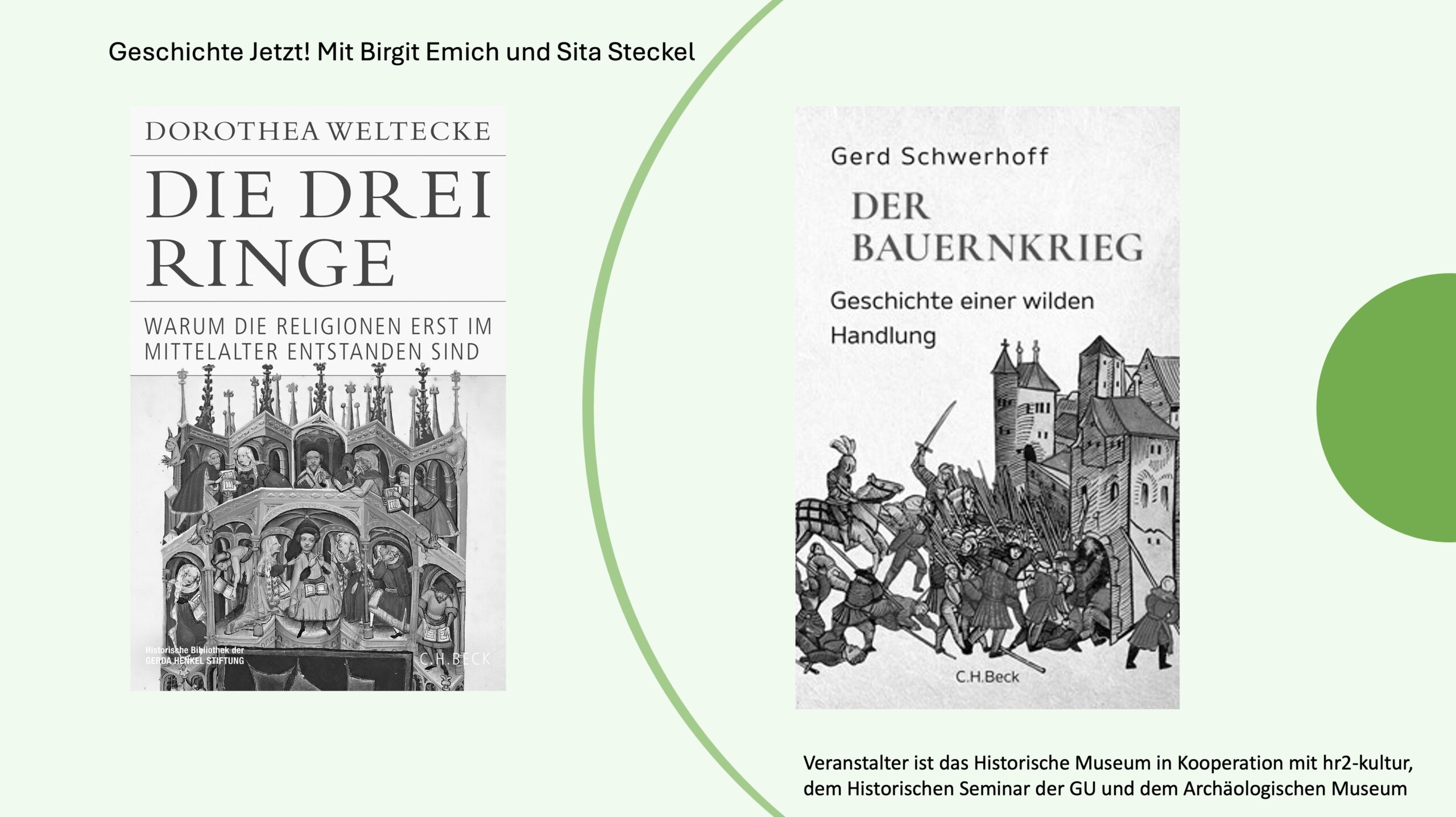Prof. Dr. Birgit Emich

Professorin für die Geschichte der Frühen Neuzeit (GU, Fb 08), Sprecherin der „Schnittstelle Religion“
Kirchenstaat, Altes Reich, 16. bis 18. Jahrhundert, Politik- und Verwaltungsgeschichte in kulturalistischer Perspektive
weitere Forschungsschwerpunkte
- Patronage, Informalität und Formalisierung
- Papsttum und Kirchenstaat in der Frühen Neuzeit
- Reformation und Konfessionskulturen
- Polyzentrik und Pluralität vormoderner Christentümer
Birgit Emich
Ich bin Professorin für die Geschichte der Frühen Neuzeit, eine Epoche, in der kirchlich-religiöse und staatlich-politische Strukturen eng verwoben waren. Damals bestimmte die religiöse Zugehörigkeit den Rechtsstatus der Menschen: Nur wer der von der Obrigkeit anerkannten Religion angehörte, genoss volle Rechte; Abweichler wurden in aller Regel diskriminiert. Hinzu kommt ein Spannungsverhältnis zwischen Einheitsanspruch und faktischer Vielfalt: Alle religiösen Gruppierungen gingen davon aus, dass es nur eine einzige Wahrheit geben könne. Allerdings beanspruchten spätestens seit der Reformation gleich mehrere Parteien diese Wahrheit für sich. Mich interessiert, wie unter diesen Bedingungen religiöse Pluralität möglich ist.
Zentrale Veröffentlichungen
HERAUSGABE
mit A. Badea et al. (Hg.), Konfessionelle Codierungen, Köln erscheint 2025.
HERAUSGABE

mit A. Fahrmeir et al. (Hg.), Revolution, Reaktion, Religion. Geschichte und Gegenwart eines komplexen VerhältnissesFrankfurt, erscheint 2025.
HERAUSGABE
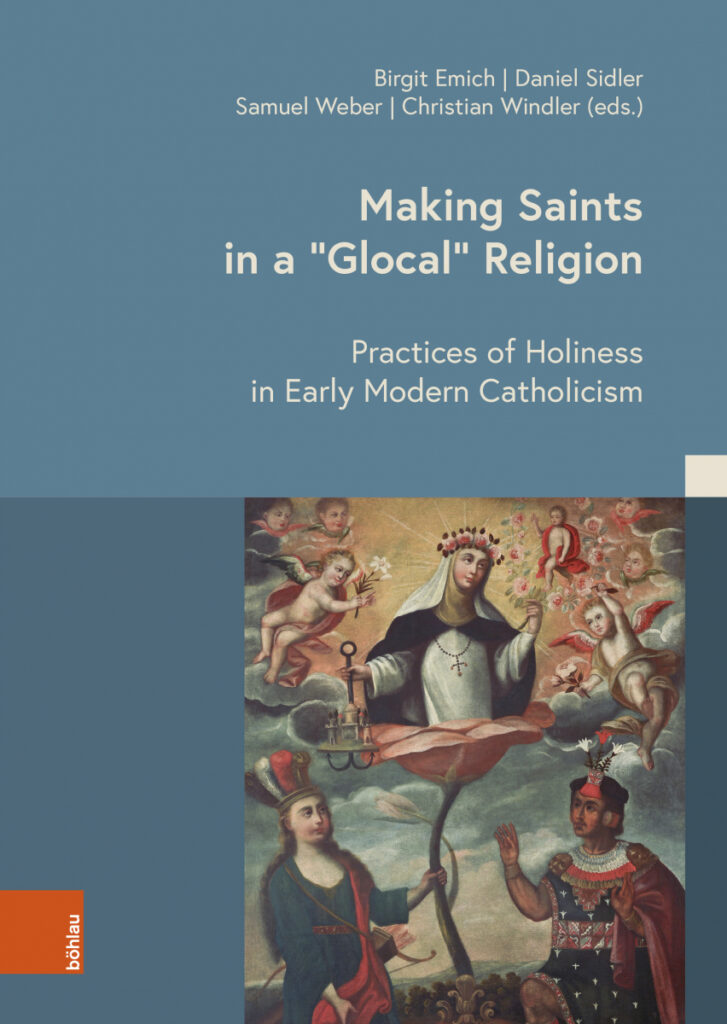
mit D. Siedler et al. (Hg.), Making Saints in a Glocal Religion: Practices of Holiness in Early Modern Catholicism, Köln 2024.
HERAUSGABE
mit A. Badea u. B. Boute (Hg.), Pathways through Early Modern Christianities, Köln 2023.
Medienauftritte
Ein vielschichtiges Verhältnis. Der Sommerkurs “Religion postkolonial?, UniReport, 11. 07. 2024.
Querdenker oder Selbstdenker: Demagogie und Populismus, Salon Sophie-Charlotte, L.I.S.A., 5. 11. 2023.
„Die Resonanz ist erschreckend gut,“ Interview mit Birgit Emich, Radio Bremen 2, 12. 03. 2022.
Wissenschaftliches und gesellschaftliches Engagement
Historisches Kolleg München (Persönliches Mitglied des Kuratoriums seit 2018)
Gerda Henkel Stiftung (Wissenschaftlicher Beirat seit 2019)
Deutsches Historisches Institut Rom (Wissenschaftlicher Beirat seit 2019)
Auszeichnungen (Auswahl)
Aufnahme in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2023)
Fragen und Antworten
Worum geht es in Ihrer jüngsten Publikation?
Momentan arbeite ich an einem Text, der die wissenschaftliche Entwicklung der Kategorie „Konfession“ in Analogie zu den Begiffen Geschlecht – Gender – Queerness beschreibt: Von einer recht starren Kategorie, die den Menschen unveränderlich gegeben zu sein schien, über die Beschreibung einer intersektionalen Gemengelage, in der sich die verschiedende Differenzkategorien wie Alter, Stand, Geschlecht und Religion überlagern, bis hin zur völligen Verflüssigung der Grenzen und Identitäten, die frei gestaltbar sind und nur im Hier und Jetzt performativ hergestellt werden. Das kann manchmal provozierend wirken; ich selbst finde die Parallelen aber sehr aufschlussreich.
Wo sehen Sie aktuelle gesellschaftliche Anknüpfungspunkte für Ihre Forschung?
Wo sehen Sie aktuelle gesellschaftliche Anknüpfungspunkte für Ihre Forschung? Aktuelle Konflikte und Debatten drehen sich stark um Fragen der Identität und Zugehörigkeit. Das war in der Frühen Neuzeit nicht anders. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich hinter diesen Fragen aber oftmals gänzlich andere Konfliktlagen. Die Religionsgeschichte der Frühen Neuzeit lehrt daher verstehen, wie Identitäten konstruiert, behauptet, instrumentalisiert, in Stellung gebracht und auch wieder entschärft werden.
Was ist die wichtigste „Big Theory“, um Entwicklungen im Bereich Religiosität zu verstehen?
Für die Konfessionsgeschichte der Frühen Neuzeit noch immer: das Konfessionalisierungsparadigma, das den Blick auf das Wechselspiel von Religionsgeschichte und Staatsbildung gelenkt hat. Es mag zwar in weiten Teilen modifiziert worden sein. Aber ein Modell mit einer solchen Reichweite und Erklärungskraft muss man erst mal finden!